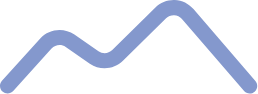.

Aktive Unterstützung
Ich unterstütze Sie aktiv dabei, nicht nur Ihr Problem zu verstehen, sondern es zu bewältigen – oder zumindest einen tragfähigen Umgang damit zu finden. Reines Erzählen kann entlasten, führt aber selten zu nachhaltiger Veränderung. Sie haben ein Recht darauf, etwas über sich zu erfahren – auch dann, wenn es irritiert oder ungewohnt spiegelt.
Therapie verstehe ich als einen kooperativen Prozess, in dem wir gemeinsam klären, was Ihnen wichtig ist, und wie wir vorgehen wollen. Ihre Ziele und meine therapeutische Erfahrung treten dabei in einen produktiven Dialog.
Veränderung braucht Zeit – aber oft nicht viel!
Veränderung braucht Zeit – aber oft weniger, als man denkt.
Viele Lösungen liegen näher, als es zunächst scheint. In meiner Praxis habe ich immer wieder erlebt, dass kurze, fokussierte Therapien erstaunlich wirksam sein können. Zahlreiche therapeutische Prozesse fanden bereits nach 10, 15 oder 25 Sitzungen ein kraftvolles, freudiges Ende.
Wer nach 20 Stunden spürbar profitiert hat, braucht oft keine 40. Und wer auch nach 10 Sitzungen kaum Veränderung erlebt, profitiert selten von einer Verdoppelung des Zeitrahmens. Darum ist es mir wichtig, dass wir nach wenigen Sitzungen gemeinsam reflektieren, was sich bereits bewegt hat – und was nicht. Sie haben ein Recht auf diese Klärung.
Ich sehe es als Teil meiner ethischen Verantwortung, Ihnen offen mitzuteilen, wenn ich den Eindruck gewinne, dass ich nicht der geeignete Therapeut für Sie bin. In einem solchen Fall unterstütze ich Sie gerne dabei, einen passenderen Rahmen zu finden.


Zielfokussierung
Was Sie erreichen wollen
Eine erfolgreiche Therapie braucht Richtung.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der therapeutische Erfolg in hohem Maß davon abhängt, wie klar die Ziele formuliert sind – und ob Therapeut und Klient sich darüber einig sind. Ein gemeinsamer Zielkonsens schafft Orientierung, stärkt das Vertrauen in den Prozess und erhöht die Wirksamkeit der Gespräche.
Ziele sind Wegweiser:
- Sie ermöglichen es, unsere Sitzungen auf ihre Zweckdienlichkeit hin zu überprüfen.
- Sie stellen sicher, dass Therapeut und Klient in dieselbe Richtung arbeiten, statt aneinander vorbeizureden.
- Sie helfen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren – für eine konzentrierte, intensive und effektive Zusammenarbeit.
Deshalb erarbeiten wir gemeinsam ein oder mehrere konkrete Ziele, an denen wir uns im therapeutischen Prozess orientieren. Falls Sie Ihre Ziele zu Beginn noch nicht benennen können, ist das kein Hindernis – dann wird die Zielfindung selbst zum ersten Ziel.
Ziele unterscheiden sich von Visionen:
Ein Ziel ist etwas, das realistisch erreichbar und überprüfbar ist – etwa ein innerer Zustand, eine Entscheidung oder eine neue Handlungsfähigkeit. Eine Vision hingegen ist ein idealtypischer Leitstern, der Orientierung gibt, motiviert und energetisiert – auch wenn er vielleicht nie ganz erreicht wird. Beide sind wichtig, aber sie erfüllen unterschiedliche Funktionen im therapeutischen Prozess. Ziele strukturieren den Weg. Visionen geben ihm Sinn.
Balance zwischen Denk- und Spürprozessen – Kopf & Herz/Bauch
Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Doch Denken allein verändert noch nichts. Man kann sich in seinen Überlegungen verlieren, sich im eigenen Kopf verfangen – und bleibt dabei innerlich unberührt.
Fragen wie „Warum bin ich depressiv?“ – „Weil ich eine Depression habe“ erklären nichts. Solche zirkulären Scheinerklärungen bleiben an der Oberfläche und führen selten zur Lösung.
Für wirkliche Veränderung braucht es mehr als logische Analyse: es braucht den Zugang zu den Gefühlen, Körperempfindungen und inneren Bildern, die das eigentliche Erfahrungswissen tragen. Logisches Denken aktiviert den Kopf, doch Integration entsteht erst, wenn auch der Körper und die Emotionen sprechen dürfen.
Ich arbeite daher zweigleisig: Einerseits bemühe ich mich, Ihre Anliegen und ihre psychologischen Hintergründe verstehend zu durchdringen – andererseits lade ich Sie ein, in Ihre Körperempfindungen und inneren Bilder hineinzuspüren.
W-Fragen aktivieren den Verstand, während Bewegungen, Körperwahrnehmungen und Glaubenssätze den Fühlprozess öffnen. Diese beiden Ebenen ergänzen sich gegenseitig.
Anstatt nur über Symptome zu spekulieren, steigen wir gemeinsam in konkrete Situationen ein – bildhaft, emotional, körperlich spürbar. So kann das Unbewusste selbst Hinweise geben, die kein reines Denken hervorbringen könnte. Erst danach macht es Sinn, die neuen Erkenntnisse wieder rational zu reflektieren.
In dieser dynamischen Balance schwingen Therapeut und Klient zwischen kognitiver Klarheit und emotionaler Resonanz:
von Kopf zu Kopf, von Herz zu Herz, von Kognition zu Intuition – in einem rhythmischen Wechselspiel, das Denken und Fühlen miteinander verbindet.
„Gefühle sind zum Fühlen da.“
(Safi Nidiaye: Das Handbuch vom positiven Umgang mit negativen Emotionen)